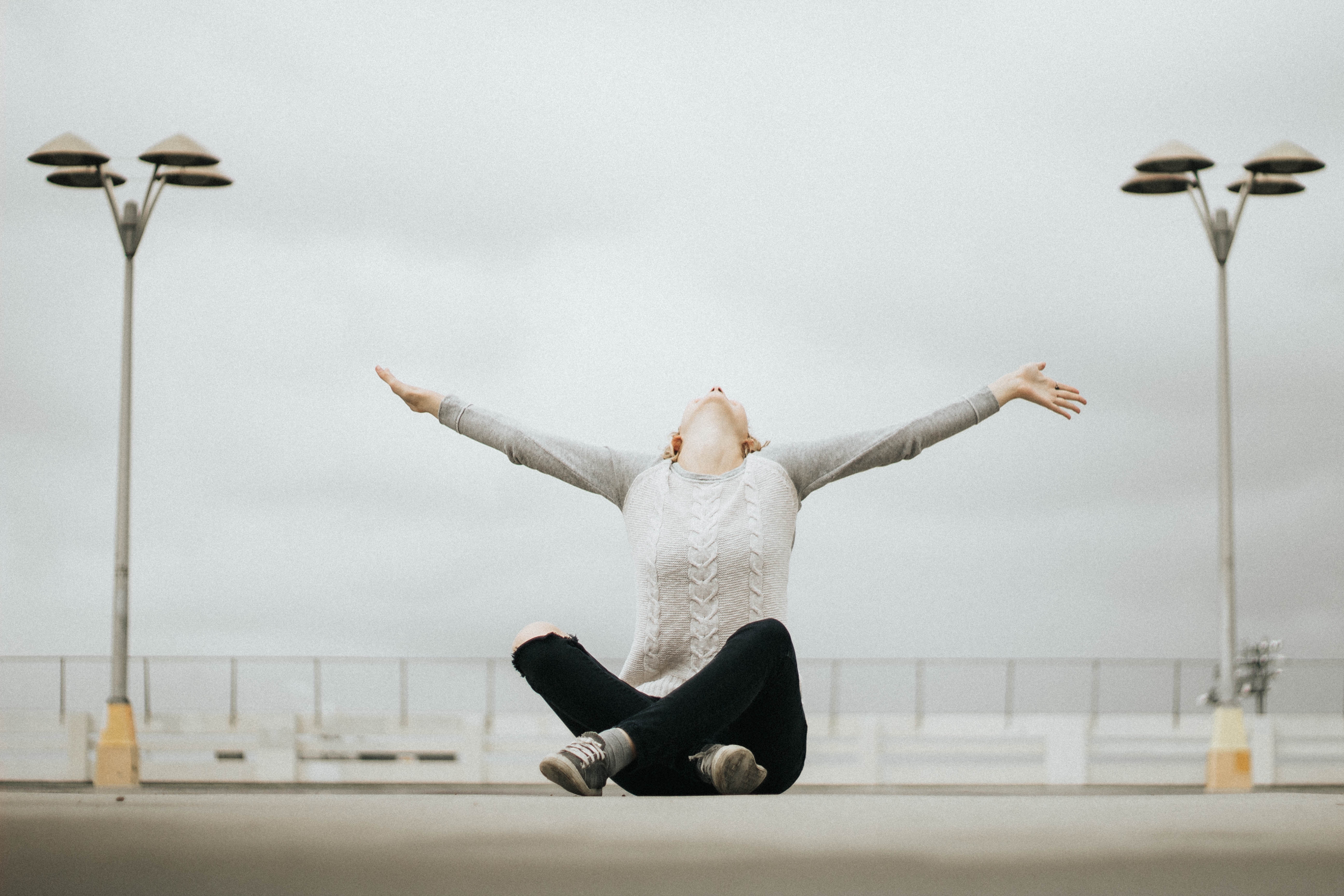Manchmal reiht sich alles aneinander: Erst sage ich einer Gruppe Freundinnen für eine gemütliche Mädelsrunde ab, dann cancel ich eine Geburtstagsfeier, lasse einen Kinobesuch ausfallen… Ich bin scheinbar nur dabei, Absagen zu erteilen und nach und nach scheint mir das jeder übel zu nehmen. Aber irgendwie ist es einfach zu viel… Treffen mit Freunden, Projekte in meiner Gemeinde, spontane Besuche, Partys, usw. Es gibt Zeiten, in denen soziale Aktivitäten kein Ende zu nehmen scheinen und aus der Sicht der anderen tun meine Absagen dies gleichermaßen, obwohl ich selbst das Gefühl habe, dauerhaft auf Achse zu sein. Kennst du das?
Geläufigerweise werden Freundes- und Bekanntenkreise doch gern in folgende zwei Kategorien eingeteilt: auf der einen Seite die, die überall mitmischen und auf der anderen die, die nie Zeit zu haben scheinen. Das sind natürlich die Blöden! Die Spaßverderber, Langweiler, Spießer. Da gehör ich jetzt also auch dazu? Komisch, so fühl ich mich aber eigentlich gar nicht.
Und ich behaupte, das liegt daran, dass bei dieser Thematik eine Menge Vorurteile und Missverständnisse im Spiel sind. Vielleicht geht es dir so wie mir und dir ist einfach nicht ständig nach Action. Ein Abend auf der Coach scheint dir heute eben viel verlockender als eine Party, die erst um Mitternacht so richtig losgeht. Vielleicht stehst du aber auch auf der anderen Seite – ganz nach dem Motto „Man lebt nur einmal!“ nimmst du jedes soziale Event mit und engagierst dich nebenbei am besten in drei Projekten auf einmal.
Ich glaube, dass diese verschiedenen Lebenseinstellungen mit unseren ganz persönlichen Grenzen zu tun haben. Inspiriert dazu wurde ich unter anderem durch das Buch „Bis hierher und nicht weiter – Wie Sie sich zentrieren, Grenzen setzen und gut für sich sorgen“ von Rolf Sellin, in dem ich vor kurzem bei einer Freundin gestöbert habe (noch nicht komplett gelesen!). Doch bevor ich näher auf diese Grenzen-Sache zu sprechen komme, möchte ich erst einmal diese Missverständnisse aus meinem Eingangsbeispiel näher betrachten:
Missverständnis Nr. 1 – die Verwechslung von Zeit und Energie
„Sorry, ich kann heute leider nicht mehr vorbeikommen – ich muss lernen, und eigentlich auch endlich mal wieder putzen, das Geschirr abwaschen… Ich hab einfach keine Zeit.“ Wer hört das schon gern? Putzen, das ist doch nun wirklich nicht lebenswichtig! Und solange die Klausur nicht zwei Tage entfernt ist, ist Lernen doch auch nicht so dringend, oder?
Meine These ist, dass solche und ähnliche Aussagen meist jedoch gar nicht so viel mit fehlender Zeit zu tun haben, obwohl das die Wortwahl der Betreffenden vermuten lässt. Häufig ist der wahre Grund für diese Absagen etwas, das ein wenig schwerer greifbar ist: Energie – und in diesem Fall: fehlende. Hast du schon einmal jemanden sagen hören: „Sorry, ich kann heute Abend leider nicht kommen, ich habe nicht genügend Energie“? Aus meiner Erfahrung liegt die Seltenheit solcher Aussagen darin begründet, dass fehlende Energie einfach kein allgemein anerkannter Grund für eine Absage ist. Denn Aussagen wie „Ich bin schon ziemlich müde“ oder „Ich hatte einen langen Tag und muss erst einmal ausruhen“, welche auf fehlende Energie hinweisen, werden schnell abgestempelt als Spaßverderberei oder gar fehlendes Interesse. Wir trauen uns also nicht, so etwas zu sagen und gerade als junger Mensch ist es manchmal schwer, sich in solch einem Fall zu rechtfertigen. Der lahme Spruch „Schlafen kannst du, wenn du tot bist“ wird beispielsweise gern als Totschlagargument in der Kneipe gebraucht, wenn man kurz davor ist, sich vom Acker zu machen. Stattdessen sagen wir also lieber, dass wir keine Zeit haben, in der Hoffnung, dass dies keine Vorwürfe zur Folge hat – denn gegen fehlende Zeit kann man schließlich nichts machen, oder? Nach meiner Erfahrung durchblicken die meisten jedoch, dass es sich dabei um Ausreden handelt. Und dann geht das Spekulieren los: „Der hat doch einfach keine Lust auf uns!“ Wäre ehrlich sein also vielleicht doch besser?
Es ist unglaublich wichtig, dass wir endlich anerkennen, dass fehlende Energie durchaus ein berechtigter Grund ist, um eine Absage zu erteilen. Wenn wir uns ausgelaugt fühlen – und sei es nur geistig! – sind wir weniger in der Lage, gute Unterhaltungen zu führen und sozial zu interagieren. Und hier kommt der Clou: Diesen Zustand erreicht jeder Mensch unterschiedlich schnell. Jeder hat seine ganz eigene Grenze, bis zu der er soziale Interaktionen genießen kann, bevor er innerlich auslaugt ist. Nur weil ich nach einem langen Arbeitstag keine Lust mehr auf einen Kneipenabend habe, muss das für einen anderen nicht genauso sein. Eine völlig falsche Interpretation wäre es jedoch, zu behaupten, dass mir meine Freunde demzufolge weniger wichtig wären. In den meisten Fällen liegt es lediglich an meinem leeren Energie-Tank. Und das führt mich zu…
Missverständnis Nr. 2 – Extrovertiert vs. Introvertiert
Dieses Thema habe ich schon einmal in meinem ersten Blog-Beitrag thematisiert. Seitdem ich mich genauer damit beschäftigt habe, was Extro- und Introvertiertheit bedeutet, wurden meine Augen entscheidend für ganz alltägliche Missverständnisse geöffnet, die häufig darauf zurückzuführen sind, dass Menschen ihre Unterschiedlichkeit in diesem Bereich nicht anerkennen.
Viele glauben, dass Extrovertierte per se sozialere, redegewandtere, „lautere“ Menschen sind – Introvertierte dagegen die Schüchternen, Ruhigen, weniger sozial Kompetenten. Dies stimmt so nicht! Extro- und Introvertiertheit sagt nämlich lediglich etwas darüber aus, wo und wie wir Energie auftanken, wodurch wir uns also wieder belebt, aktiv und gut fühlen. Und dies ist der entscheidende, zu selten berücksichtigte Unterschied: Extrovertierte tanken Energie durch das Zusammensein mit anderen Menschen und Introvertierte durch Zeiten mit sich selbst. Sicherlich geht das häufig damit einher, dass Extrovertierte selbstbewusster auftreten und Introvertierte eher schüchtern wirken. Oft ist das jedoch nur der äußere Schein!
Ich erfahre dieses Klischee-Denken häufig selbst. In manchen Kreisen trete ich sehr ruhig und zurückhaltend auf, woraus geschlussfolgert wird, dass ich schüchtern bin oder einfach nicht so viel zu sagen habe. Vielmehr hat es jedoch damit zu tun, dass ich gern erst einmal beobachte und mir eine Meinung bilde. Menschen, die mich gut kennen und Kreise, in denen ich mich wohl fühle, erleben mich dagegen ganz anders: denen fällt es eher schwer zu glauben, dass ich introvertiert bin. Denn ehrliche, offene soziale Interaktion macht mir unglaublich viel Spaß! Und dennoch – ich tanke Energie in der Einsamkeit. Nach einer langen Feier bin ich ausgelaugt und habe viele Eindrücke zu verarbeiten. Dafür muss ich allein sein. Extrovertierte Menschen sind dagegen umso energiegeladener, nachdem sie gute Gespräche geführt und das Zusammensein mit Freunden genossen haben. Sie können dann häufig umso motivierter die nächste Herausforderung anpacken.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in eine der beiden Richtungen tendiert. Und selbst, wenn du dich in verschiedenen Bereichen unterschiedlich erlebst – wünschst du dir nicht, dass andere Menschen deine persönliche Art und Weise, Energie zu tanken, anerkennen? Es ist wichtig, zu erkennen dass Verschiedenheit manchmal nicht so schnell und einfach nachzuvollziehen und dennoch okay ist, ja sogar bereichernd. Und manchmal liegt sie eben auch in etwas so negativ Klingendem wie „Grenzen“.
Was sind deine persönlichen Grenzen?
Das Bedürfnis abzusagen, und es doch nicht zu tun, ein leerer Energietank, ein zu langer Kneipenabend… Das sind nur Beispiele dafür, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, uns erfolgreich von anderen abzugrenzen und zu uns selbst zu stehen. Denn leider nehmen wir es häufig als etwas Negatives war, auch einmal „nein“ zu anderen zu sagen.
Versuch einmal, dir folgende oder ähnliche Fragen zu stellen: Wie viel Zeit kannst du mit anderen Menschen verbringen, bevor es dir zu viel wird? Wie oft willst du allein sein? Wie durchgehend möchtest du erreichbar sein? Bleibst du manchmal länger bei einer Feier, als dir lieb ist, nur um nicht als Spaßverderber da zustehen oder den Gastgeber zu kränken?
Für mich waren solche Fragen sehr wertvoll, um zu erkennen, dass ich manchmal überhaupt nicht auf meine persönlichen Grenzen achte. Oft weiß ich zwar, was ich will und was mir gut tut, setze es jedoch nicht um. Und was sind die Folgen davon? Wenn ich irgendwo hingehe, obwohl ich gar keine Energie mehr habe oder irgendwo länger bleibe, obwohl ich fast einschlafe, hat das meist nur negative Auswirkungen. Ich bekomme nach und nach schlechte Laune, fühle mich ausgelaugt und überhaupt nicht mehr gesellig – und Geselligkeit sollte doch eigentlich der Sinn der Sache sein. Es nützt also niemandem etwas, wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht respektieren.
Andersherum geht es jedoch auch nicht darum, die eigenen Grenzen lediglich abzustecken und sich dann im sicheren Umfeld zu isolieren. Vielmehr hilft es, die eigenen Grenzen ganz bewusst gestalten.
Was es bedeutet, Grenzen aktiv zu gestalten
Zuerst einmal sollten wir nicht davon ausgehen, dass andere Menschen automatisch verstehen, wo unsere Grenzen liegen. Es kann beispielsweise nicht jeder sofort sehen, ob du extro- oder introvertiert bist. Deswegen müssen wir klar kommunizieren, wenn eine Grenze überschritten wird. In meinem oben genannten Beispiel der Absagen würde das also bedeuten, dass wir bewusst zu unserer fehlenden Energie stehen (natürlich auch zu unserer fehlenden Zeit, wenn das tatsächlich der Fall ist). Es ist okay, wenn wir sagen: „Ich hätte zwar theoretisch Zeit, aber ich brauche mal wieder ein wenig Zeit nur für mich.“ Sicherlich, viele werden erst einmal verdutzt sein, wenn du so etwas sagst und nicht einmal versuchst, dich zu rechtfertigen. Aber du wirst dadurch automatisch greifbarer für andere! Vielleicht verstehen deine Freunde es nicht beim ersten Mal, aber nach und nach werden sie begreifen, wie du tickst und können besser mit deinen persönlichen Grenzen umgehen. Außerdem steigerst du dadurch dein Selbstbewusstsein und wirst höchstwahrscheinlich auch als selbstbewusster wahrgenommen.
Doch es geht nicht nur darum, immer „nein“ zu sagen (obwohl es manchmal auch nötig sein kann, erst einmal in diese Richtung zu „trainieren“, um ein Gefühl für dieses Wort zu bekommen). Wenn wir in der Lage sind, zu erkennen, wann uns etwas zu weit geht und wissen, wo unsere Grenzen liegen, können wir auch den Spielraum innerhalb dieser Grenzen besser ausnutzen und sogar erweitern! Dies müssen wir jedoch selbst aktiv tun. Wenn wir unsere Grenzen nämlich nur passiv von anderen einrennen lassen, verlieren wir nach und nach das Gefühl der Selbstwirksamkeit und werden im schlimmsten Fall schlecht gelaunt und aggressiv.
Rolf Sellin zeigt in seinem Buch auf, dass wir dann am erfolgreichsten unsere Grenzen erweitern können, wenn wir uns kurz vor deren Überschreitung bewegen, wenn wir also bis „an unsere Grenzen“ gehen. Stell dir beispielsweise vor, du hast einen Freund, der sich ständig mit dir treffen möchte. Du hast jedoch oft keine Lust, weil du weißt, dass dieser Freund zwar sehr nett, aber eine ziemliche Plappertasche ist und du bist dagegen eher der ruhige Typ. Ein Treffen mit ihm raubt dir immer sehr viel Energie, weswegen du dir Ausreden einfallen lässt, um ihn abzusagen. Auf Dauer wird das jedoch sehr frustrierend, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass dir jemand deine Grenzen einrennt. Auch dein Freund wird wahrscheinlich irgendwann traurig sein, weil er früher oder später durchschaut, dass du nur Ausreden parat hast. Was könntest du stattdessen tun?
Wenn du wirklich keine Kraft für ein Treffen mit deinem Freund hast, dann sag ihm ab und sei ehrlich. Doch es wird sicherlich auch wieder eine Zeit kommen, in der du Energie übrig hast. Und dann nutze diese Zeit! Auch wenn du weißt, dass es anstrengend sein könnte, lade deinen Freund ganz bewusst dann ein, wenn du dich energiegeladen genug fühlst, dich auf das Treffen einzulassen – wann auch immer das für dich ist. Vielleicht wird es dich an deine Grenzen bringen, aber du hast im Vorhinein selbst einen Zeitpunkt gewählt, an dem dich diese Grenzerfahrung nicht „ausknockt“. Du hast sie selbst bewusst gestaltet und konntest dich so besser auf deinen Freund einlassen. Vielleicht wird es dadurch beim nächsten Mal schon viel leichter, weil du ihm ohne verdeckte Frustration begegnen konntest. Und vielleicht auch ein wenig mehr plappern konntest?
Grenzen zu ziehen ist für viele, und ich bin darin absolut eingeschlossen, jedoch keine leichte Sache. Oft ist es nämlich schon schwer genug, erst einmal selbst zu erkennen, wo das persönliche „bis hierher und nicht weiter“ überhaupt liegt und zu akzeptieren https://puttygen.in , dass das nicht komisch ist, auch wenn viele anders ticken.
Kennst du solche Grenzerfahrungen? Fühlst du dich auch manchmal im Freundeskreis unverstanden – oder werden deine Grenzen eher in anderen Bereichen überschritten? Dies ist ein sehr weites, komplexes Thema und ich würde mich freuen, von deinen Erfahrungen zu lesen!
Constanze